Darf man bei einem Zoo-Besuch auch etwas vom Tier essen? Oder wäre ein vegetarischer „Chicken Nugget“ vielleicht angebrachter? Über diese Frage zoffen sich Besucher und Besucherinnen seit geraumer Zeit auf der Facebook-Seite des Zürcher Zoos. Dieser hatte, nach einer Versuchsphase im Herbst, die vor allem bei Familien beliebten Chicken Nuggets durch „Crispy Nuggets“ aus Cornflakes, Weizen und Soja ersetzt – um das Angebot im zoo-eigenen Restaurant vielfältiger und nachhaltiger zu gestalten, wie Zoo-Direktor Severin Dressen dem „Tagblatt der Stadt Zürich“ sagte. Die Versuchsphase sei sehr gut verlaufen, schob Dressen nach, auch die Reaktionen seien mehrheitlich positiv. Und bei einer Blinddegustation der Geschäftsleitung habe niemand – ihn eingeschlossen – die Rohstoffe für die Nuggets fehlerfrei zuordnen können.

Zoo-Direktor Severin Dressen bei der Nuggets-Degustation
Tatsächlich gibt es bei den über 120 Kommentaren auf Facebook auch positive. „Mega fein“ seien die neuen Getreidenuggets, meint eine Mutter etwa. „Verratet Ihr uns den Produzenten? Würde es gern zu Hause essen.“ Eine andere schreibt: „Ihr seid die Besten! Vielen Dank, dass Ihr ein Zeichen setzt.“ Aber es gibt eben auch die Unversöhnlichen: „Ich finde es eine verdammte Sauerei, dass man sich immer wieder den scheinheiligen Weltverbesserern anpassen muss. Es gibt auch noch andere Zoos, und sonst nehme ich mir mein Schnitzel und meine Wurst selber mit.“ Jemand fragt: „Bekommen die Löwen nun auch nur noch vegetarische Kost?“ Vor allem die Kinder, so liest man gleich mehrmals, hätten gar keine Freude am neuen Angebot: „Zuerst der Zoo-Burger völlig verändert, nun noch die Nuggets. Schade, denn beide Alternativen dafür essen meine Kinder nicht. Nun gibt’s also nur noch Pommes.“
Ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei den neuen Zoo-Nuggets nicht um eine Kleinigkeit, sondern um ein durchaus gewichtiges Thema handelt: Pro Jahr wurden bisher zehn Tonnen der Variante aus Hühnerfleisch etc. verkauft und – so darf man vermuten – hauptsächlich von Kindern mit ihrem feinen Gaumen verspeist. Wenn diese die Getreidenuggets so vehement ablehnen, müsste sich das eigentlich negativ in der Statistik der bestellten Mahlzeiten niederschlagen, denkt man sich. Und tatsächlich hat das Zoo-Restaurant Veränderungen festgestellt: Die Zahl der bestellten Nuggets für Erwachsene hat nach der Umstellung leicht abgenommen. Nicht so allerdings bei den Kinderportionen; von diesen sind sogar noch deutlich mehr als früher verkauft worden.




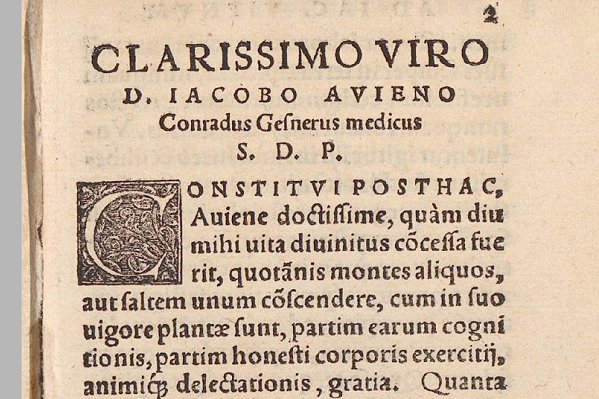

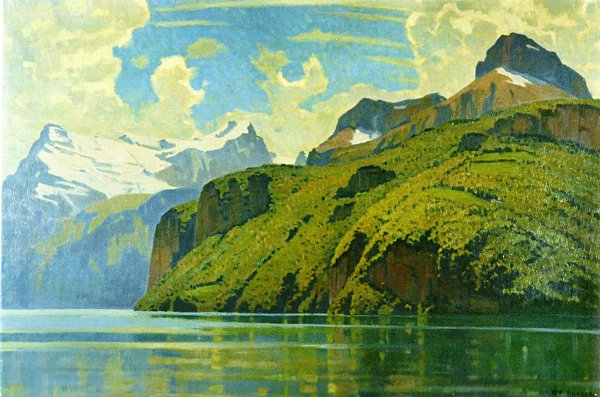




 Aline Valangin hat der bewegten Geschichte von Spruga und Comologno in ihrem Doppelroman „Die Bargada / Dorf an der Grenze“ auch ein Denkmal gesetzt. Im äusserst lesenswerten Buch schildert sie das Leben in diesem abgelegenen Winkel der Schweiz, besonders auf einem sehr speziellen Hof, wo die Frauen über die Jahrhunderte immer wieder das Sagen haben – weil die Männer auswärts einen Verdienst suchen müssen oder schlicht zu schwach sind, der zupackenden Art der Frauen etwas Ebenbürtiges entgegenzusetzen. Im zweiten Buch geht es dann um den Schmuggel, der das Dorf und dessen Leute stark verändert. Aber auch um die Partisanen, die allmählich die Schmuggler ablösen und das Dorf als Zufluchtsort sehen. Dieses zweite Buch konnte lange nicht veröffentlicht werden – vielleicht auch deshalb, weil Aline Valangin die offizielle Schweizer Flüchtlingspolitik sehr ungeschminkt schildert. Sie beschreibt, wie man die fliehenden Nazi-Soldaten reinlässt, die Partisanen aber vor der Grenze den Angriffen preisgibt. Recht willkürlich wirken die Entscheide „von Bern“, welche Flüchtlinge man aufnehmen will und welche man auf dem beschwerlichen Weg wieder nach Italien zurückschickt. Ein äusserst lesenswertes, spannendes Stück Schweizer Literatur und Geschichtsschreibung. Weitere Informationen finden sich zum Beispiel auf der
Aline Valangin hat der bewegten Geschichte von Spruga und Comologno in ihrem Doppelroman „Die Bargada / Dorf an der Grenze“ auch ein Denkmal gesetzt. Im äusserst lesenswerten Buch schildert sie das Leben in diesem abgelegenen Winkel der Schweiz, besonders auf einem sehr speziellen Hof, wo die Frauen über die Jahrhunderte immer wieder das Sagen haben – weil die Männer auswärts einen Verdienst suchen müssen oder schlicht zu schwach sind, der zupackenden Art der Frauen etwas Ebenbürtiges entgegenzusetzen. Im zweiten Buch geht es dann um den Schmuggel, der das Dorf und dessen Leute stark verändert. Aber auch um die Partisanen, die allmählich die Schmuggler ablösen und das Dorf als Zufluchtsort sehen. Dieses zweite Buch konnte lange nicht veröffentlicht werden – vielleicht auch deshalb, weil Aline Valangin die offizielle Schweizer Flüchtlingspolitik sehr ungeschminkt schildert. Sie beschreibt, wie man die fliehenden Nazi-Soldaten reinlässt, die Partisanen aber vor der Grenze den Angriffen preisgibt. Recht willkürlich wirken die Entscheide „von Bern“, welche Flüchtlinge man aufnehmen will und welche man auf dem beschwerlichen Weg wieder nach Italien zurückschickt. Ein äusserst lesenswertes, spannendes Stück Schweizer Literatur und Geschichtsschreibung. Weitere Informationen finden sich zum Beispiel auf der 

