Jahr für Jahr wird in Zürich gejammert über die zahlreichen Baustellen, die für Staub und Dreck sorgen und einem den Weg versperren. Blickt man 150 Jahre zurück, relativiert sich allerdings die Situation gewaltig. Ich durfte für die Stadtzunft, die gerade ihr 150-jähriges Bestehen feiert, einen längeren Beitrag für ihr Jubiläumsbuch schreiben und konnte mich wieder einmal wundern darüber, wie rasch und tiefgreifend sich Zürich damals innert weniger Jahrzehnte verändert hat. In den dreissiger Jahren gab es einen ersten richtigen Schub: Die Schanzen wurden abgebrochen, was Raum bot für zahlreiche Bauten im inneren Kern der Stadt. Durch die engen Gässlein wurde eine neue Achse geschlagen, die den Postkutschen komfortablere Verhältnisse schuf. Beim heutigen Sechseläutenplatz entstand ein Kornhaus, die Münsterbrücke wurde gebaut, und zwischen Münsterhof und Paradeplatz wurde eine neue, breite Strasse angelegt. Passenderweise wurde an dieser Strasse die neue Post angelegt, wo die Kutschen ankamen und wegfuhren, die zuvor die engen Gassen der Altstadt verstopft hatten. Die Reiseführer lobten damals das neue Gebäude – und das gegenüber liegende Hotel Baur, das nobelste Gasthaus der Stadt. Gleichzeitig entschuldigte man sich bei den Touristen: Zürich sei ja normalerweise eine saubere Stadt. Weil aber momentan so viel gebaut werde, sei es entsprechend staubig und dreckig. Nach 1860 wurde die Stadt dann regelrecht umgestochen: Schanzengraben und Sihlkanal wurden verlegt, der Fröschengraben zugeschüttet und darauf die Bahnhofstrasse angelegt, ganze Quartiere neu gebaut – und andere vollständig beseitigt. Die schöne neue Post war nun ebenso überflüssig geworden wie das Kornhaus auf dem Sechseläutenplatz: Das Postgebäude wurde vorübergehend an die Kreditanstalt vermietet, das Kornhaus zur Tonhalle umgebaut und deren Betrieb in ein neues Gebäude beim Bahnhof verlegt. Die Bahn hatte innert kurzer Zeit die Kutschen überflüssig gemacht.
 Man muss der Stadtzunft danken dafür, dass sie nicht einfach eine Jubiläumsbroschüre verfasst hat, sondern mit einigem Aufwand ein richtiges Zürich-Buch geschaffen hat, das die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in allen Facetten beleuchtet. Diverse namhafte Autoren haben sich daran beteiligt und beispielsweise die Bereiche Wirtschaft, Kultur oder politische Geschichte näher untersucht. Eingerahmt werden diese Fachartikel durch einen Stadtspaziergang um 1867 und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung Zürichs. Und fast noch mehr als über die Geschichte der Stadt lässt sich staunen über die grosse Zahl von Bildern, die davon noch Zeugnis ablegen. Viele Fotos und Illustrationen hat man noch nie oder wenigstens schon sehr lange nicht mehr in einer Publikation gesehen.
Man muss der Stadtzunft danken dafür, dass sie nicht einfach eine Jubiläumsbroschüre verfasst hat, sondern mit einigem Aufwand ein richtiges Zürich-Buch geschaffen hat, das die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in allen Facetten beleuchtet. Diverse namhafte Autoren haben sich daran beteiligt und beispielsweise die Bereiche Wirtschaft, Kultur oder politische Geschichte näher untersucht. Eingerahmt werden diese Fachartikel durch einen Stadtspaziergang um 1867 und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung Zürichs. Und fast noch mehr als über die Geschichte der Stadt lässt sich staunen über die grosse Zahl von Bildern, die davon noch Zeugnis ablegen. Viele Fotos und Illustrationen hat man noch nie oder wenigstens schon sehr lange nicht mehr in einer Publikation gesehen.





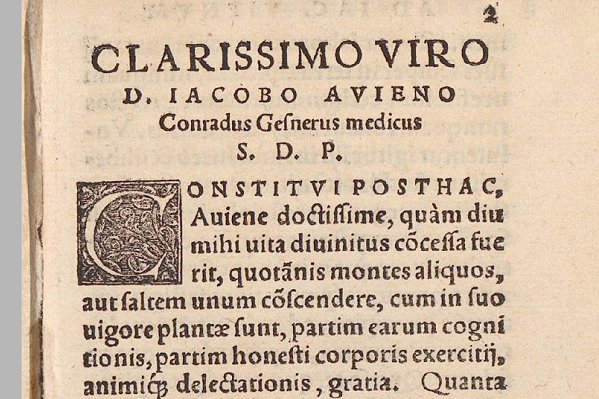


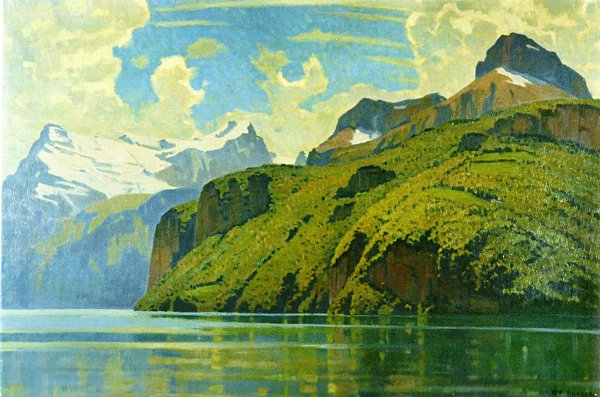




 Aline Valangin hat der bewegten Geschichte von Spruga und Comologno in ihrem Doppelroman „Die Bargada / Dorf an der Grenze“ auch ein Denkmal gesetzt. Im äusserst lesenswerten Buch schildert sie das Leben in diesem abgelegenen Winkel der Schweiz, besonders auf einem sehr speziellen Hof, wo die Frauen über die Jahrhunderte immer wieder das Sagen haben – weil die Männer auswärts einen Verdienst suchen müssen oder schlicht zu schwach sind, der zupackenden Art der Frauen etwas Ebenbürtiges entgegenzusetzen. Im zweiten Buch geht es dann um den Schmuggel, der das Dorf und dessen Leute stark verändert. Aber auch um die Partisanen, die allmählich die Schmuggler ablösen und das Dorf als Zufluchtsort sehen. Dieses zweite Buch konnte lange nicht veröffentlicht werden – vielleicht auch deshalb, weil Aline Valangin die offizielle Schweizer Flüchtlingspolitik sehr ungeschminkt schildert. Sie beschreibt, wie man die fliehenden Nazi-Soldaten reinlässt, die Partisanen aber vor der Grenze den Angriffen preisgibt. Recht willkürlich wirken die Entscheide „von Bern“, welche Flüchtlinge man aufnehmen will und welche man auf dem beschwerlichen Weg wieder nach Italien zurückschickt. Ein äusserst lesenswertes, spannendes Stück Schweizer Literatur und Geschichtsschreibung. Weitere Informationen finden sich zum Beispiel auf der
Aline Valangin hat der bewegten Geschichte von Spruga und Comologno in ihrem Doppelroman „Die Bargada / Dorf an der Grenze“ auch ein Denkmal gesetzt. Im äusserst lesenswerten Buch schildert sie das Leben in diesem abgelegenen Winkel der Schweiz, besonders auf einem sehr speziellen Hof, wo die Frauen über die Jahrhunderte immer wieder das Sagen haben – weil die Männer auswärts einen Verdienst suchen müssen oder schlicht zu schwach sind, der zupackenden Art der Frauen etwas Ebenbürtiges entgegenzusetzen. Im zweiten Buch geht es dann um den Schmuggel, der das Dorf und dessen Leute stark verändert. Aber auch um die Partisanen, die allmählich die Schmuggler ablösen und das Dorf als Zufluchtsort sehen. Dieses zweite Buch konnte lange nicht veröffentlicht werden – vielleicht auch deshalb, weil Aline Valangin die offizielle Schweizer Flüchtlingspolitik sehr ungeschminkt schildert. Sie beschreibt, wie man die fliehenden Nazi-Soldaten reinlässt, die Partisanen aber vor der Grenze den Angriffen preisgibt. Recht willkürlich wirken die Entscheide „von Bern“, welche Flüchtlinge man aufnehmen will und welche man auf dem beschwerlichen Weg wieder nach Italien zurückschickt. Ein äusserst lesenswertes, spannendes Stück Schweizer Literatur und Geschichtsschreibung. Weitere Informationen finden sich zum Beispiel auf der 